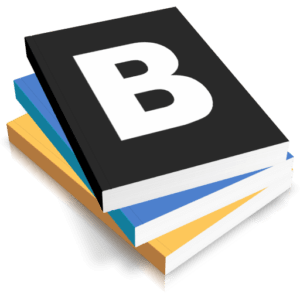DU0389V
| Sohn der Nacht – Vampirroman Ursula Donner ISBN 9783942322003, fallen star Verlag, broschiert, 188 Seiten, € 14,90 |
Seine Profession ist der Tod. Deshalb darf die Patriziertochter Ilaria, die ihn auf dem Carnevale das erste Mal sieht, nicht wissen, wer er ist und was er ist: Alessio, der Vampir mit der Pestmaske. Weder kennt sie sein Gesicht noch seinen Namen. Dennoch ist er der Einzige, dem sie vertrauen kann, als sie aus ihrem Elternhaus flieht. Ilaria ahnt nicht, dass ihn ein dunkles Geheimnis mit ihrer Familie verbindet. Gejagt von der eigenen Vergangenheit muss Alessio sich seinen größten Ängsten stellen. Als sich die Schatten zu einer Macht manifestieren, die ihn und alles, was er liebt, vernichten will, gerät auch Ilaria, die sein untotes Herz erneut schlagen lässt, in allergrößte Lebensgefahr.
In der Stadt Venedig im Oktober des Jahres 1750
Nebel wand sich um die Gräber, wogte über die kiesbedeckten Wege und umschlang die Statuen der Todesengel. Alessio verspürte ein Kribbeln zwischen den Schulterblättern, als ruhten Augen auf ihm, doch er nahm niemanden wahr. Wer sollte hier sein zu solch später Stunde? Verlassener und trostloser als je zuvor erschien ihm der Friedhof. Alessio setzte seinen Weg zwischen den Gräbern fort. Eine Böe riss ihm die Kapuze seines Umhangs vom Kopf. Die Rose für Cassandra hielt er schützend an sich gepresst, während er mit der freien Hand die Kapuze wieder über sein Haar zog.
Regen setzte ein, feiner Regen, der sich mit dem Mondlicht zu einem silbernen Schleier verwob. Einige Regentropfen fanden den Weg an Alessios Pestmaske vorbei und rannen seine Wangen herab. Sie ließen ihn an Tränen denken, von denen er unzählige für Cassandra vergossen hatte. Cassandra, deren Todestag sich heute zum 175. Mal jährte. Doch war es ihm, als stürbe sie Nacht für Nacht. Hier war er allein mit seiner Trauer und seinen Erinnerungen. Allein?
Kies knirschte. Alessio fuhr herum und erblickte Jean-François, den er länger kannte als jeden Menschen. Auf dessen Lippen lag jenes ironische Lächeln, das so typisch für ihn war. Seine mitternachtsblauen Augen gaben keine Seele zu erkennen. Nichts reflektierten sie als die Kälte des Weltalls.
„Bonsoir“, sagte Jean-François.
„Warum schleichst du hier herum?“
„Von Herumschleichen kann keine Rede sein. Du bist unachtsam geworden, mon ami. In der alten Zeit wäre dir dies nicht passiert.“ Jean-François lächelte. „Ich hätte dich umbringen können, wäre dies meine Absicht gewesen.“ Betont provokant, wie es Alessio erschien, strich Jean-François sich eine dunkelbraune Locke aus dem Gesicht. Dessen Mantel stand offen und gab den Blick frei auf eine Moiré-Weste sowie ein Justeaucorps und Kniehosen aus weinrotem Seidensamt. Wie schlicht fand Alessio dagegen seine eigene Kleidung, die ebenso schwarz war wie sein Haar. Doch selbst ohne die Luxusgesetze würde er keine andere tragen. Seine Profession gebot es.
„Mich an Cassandras Todestag zu stören finde ich pietätlos“, sagte Alessio.
„Der Tag ist mir entfallen. Davon abgesehen macht es keinen Unterschied. Cassandras Geburtstag, ihr Namenstag. Der Tag, an dem Cassandras Lieblingshuhn geschlachtet wurde, weil es ihrem Vater auf die Schuhe schiss. Gedenktage, wohin ich blicke. Stets komme ich ungelegen, also kann es mir ebenso gut gleichgültig sein.“ Jean-François lachte leise.
„Ich hoffe, du hast einen guten Grund, hier zu sein.“
„Einen Grund? Ich brauche keinen Grund. Ich kann mich in Venedig aufhalten, wann ich will. Hier steht kein Schild: Raus mit euch fremden Vampyren, Franzosen und anderem Gesindel.“
„Als würde dich das aufhalten.“
„Non. Davon abgesehen bist du mir noch etwas schuldig.“
Alessio starrte ihn an. „Wegen dieser Nichtigkeit kommst du hier auf den Friedhof und belästigst mich am Todestag meiner Geliebten?“ Alessio wandte sich brüsk ab und lief durch die Reihen der Gräber. Er war froh, dass der Wind endlich verebbte.
„Für mich ist es keine Nichtigkeit“, sagte Jean-François, der ihm zu Cassandras Ruhestätte folgte. Die Zeit hatte den Grabstein nachdunkeln lassen, doch die darin eingravierte Rose war unversehrt. Alessio schloss seine Hand fester um den Stiel der opalweißen Rose. Blut lief über seine Finger, als die Dornen seine Haut durchstachen.
„Cassandra wird meine Anwesenheit hier wohl kaum stören. Sie ist tot.“ Jean-François und trat näher an das Grab heran. „Denkst du, unter dieser Steinplatte ist nach all der Zeit noch etwas von ihr übrig?“ Er schüttelte den Kopf. „Non, mon ami. Tu dir selbst einen Gefallen und lasse sie in Ruhe. Etwas, das du schon zu ihren Lebzeiten hättest tun sollen.“
„Du hast sie von Anfang an nicht gemocht.“
„Ich muss nicht jeden mögen. Hübsch war sie, doch das war schon ihr einziger Vorzug. Man konnte sie ertragen, solange sie ihren Mund nicht aufmachte.“
„Du schätzt es nicht, wenn Frauen eine eigene Meinung haben?“
Jean-François lachte leise. „Als hätte Cassandra eine eigene Meinung besessen. Ihr fehlten zudem geistige Gaben.“
„Sie war nicht dumm. Es mangelte ihr allein an Bildung. Dafür konnte sie nichts.“
„Sie besaß kein Rückgrat und dafür konnte sie durchaus etwas. Ich hätte sie zum Teufel gejagt.“
„Zum Teufel, dort wo deine liebe Mutter ist?“
Jean-François hob eine Augenbraue. „Gewiss betreibt meine Mutter jetzt ein Bordell in der Hölle, und wie ich sie kenne, ist sie damit überaus erfolgreich. Ein wenig Unterstützung könnte dennoch nicht schaden.“
„So eine Unverschämtheit. Cassandra hätte niemals …“
„War doch nur Spaß.“
„Bist du jetzt endlich damit fertig, an ihrem Grab schlecht über sie zu reden?“
„Ich habe gerade erst begonnen.“ Jean-François lächelte. „Non, im Ernst, mon ami. Lass Cassandra endlich hinter dir. Sie ist Vergangenheit und kommt nie wieder.“
„Das geht dich nichts an.“
„Gewiss nicht. Doch ich mache mir Sorgen um dich.“
„Du machst dir Sorgen?“ Alessio lachte. „Ich glaube es nicht.“
„Glaube, was du willst, doch es ist wahr. Immerhin bin ich dein Vater.“
„Wie rührend.“ Alessio lachte freudlos. „Doch ich habe keinen Vater. Hatte niemals einen.“ Bitterkeit lag in seiner Stimme. „Was willst du von mir?“ fragte Alessio.
„Vielleicht plagt mich mein Gewissen.“
„Etwas, das du unmöglich besitzt. Komme zur Sache.“
„Können wir beide nicht einfach das Leben genießen? Warum ist das so schwer für dich?“
„Genießen? Bei all der Schuld, die ich trage?“
„Du warst nie frei von Schuld.“
Alessio schwieg. So Unrecht hatte Jean-François nicht. Alessio starrte auf das Grab vor sich. Cassandra hatte niemals von seiner Profession als Auftragsmörder erfahren.
„Gewiss kannst du so weitermachen wie bisher“, sagte Jean-François, „doch führt das nur ins Verderben.“
„Im Verderben bin ich bereits. Wie gesagt, es ist meine Angelegenheit. Ist morgen Nacht akzeptabel?“ Es klang unfreundlicher, als Alessio es beabsichtigte.
„Pardon?“ fragte Jean-François.
„Zur Einlösung der Schuld.“
„Absolut. Ich komme zu dir.“ Jean-François lächelte. „A bien tôt.“ Er wandte sich um und ging davon.
Alessio schritt näher an Cassandras Grab heran. Er beugte sich nieder, um die Rose daraufzulegen, da sah er sie.
Alessio erstarrte. Er erstarrte, wie es nur der wandelnde Tod vermochte. Sein totes Herz hörte auf zu schlagen und sein Atem erlosch.
Eine Rose lag dort. Eine schwarze Rose. Wind und Regen hatten sie auf den Friedhofsboden gedrückt. Ihr Stiel war geknickt, die Blütenblätter schwer von schimmernden Tropfen. Sie bot ein Bild morbider Schönheit, doch waren die Erinnerungen, die sie in Alessio erweckte, alles andere als schön.
Massimo. Einzig Massimo hatte jemals schwarz gefärbte Rosen auf Cassandras Grab gelegt. Massimo, der in verbotener Liebe zu seiner Cousine entbrannt war. Obwohl Cassandra diese Liebe nie erwiderte, war Massimo der Ansicht, Alessio habe sie ihm weggenommen. Massimo verfolgte ihn mit einem Hass, der zu einem Feuer auswuchs, das heißer brannte als die Feuer der Hölle.
Doch es war nicht mehr von Bedeutung. Nichts war mehr von Bedeutung. Alle waren lange tot. Alle, außer Alessio, der verdammt war zu ewigem Leben. Cassandra und ihr Cousin starben im selben Jahr. Cassandras Überreste lagen im Grab zu Alessios Füßen. Massimo hingegen fand sein Ende durch die Pest in einem Massengrab auf der Insel des Schmerzes. Der Wind trug nun ihre Seelen. Der verfluchte Wind, der die schwarze Rose zu ihm geweht hatte, um ihn mit Erinnerungen zu quälen.
In der Ferne verhallten die Glocken einer Kirche, da stieg Ilaria aus einem Fenster des Palazzo Riguccio. Vorsichtig ertastete sie die Sprossen, denn zwischen den Weinranken konnte sie ihre Strickleiter kaum erkennen.
Im Schatten der Gasse blieb Ilaria stehen und blickte sich um. Niemand war zu sehen. Sogleich eilte sie weiter und bog um die nächste Häuserecke. Dort blieb sie stehen, um den Sitz ihres rauchgrauen Rocks und der Kniehose zu überprüfen. Beide Kleidungsstücke waren ihr etwas zu groß, denn sie stammten von ihrem Bruder. Vorsichtig fuhr sie sich über ihr Haar, einer Flut mühsam zu einem Zopf gebändigter schwarzer Locken. Sie hatte sie grau gepudert hatte, um weniger aufzufallen. Eine Maske verbarg die obere Hälfte ihres Gesichts.
Ilaria hob den Blick, als sie die Geräusche eines Stocks hörte. Ihr Bruder Enrico kam näher. Der Wind zog an seinem offenen Mantel. Darunter trug er eine graue Weste zu der Kniehose und dem Justeaucorps in jenem Taubenblau, das Ilaria so gut an ihm gefiel. Sein Haar hatte er sorgsam unter einer gepuderten Perücke und einem Dreispitz verborgen.
Enrico verzog den Mund zu einem süffisanten Lächeln. „Ah, da sind Sie ja endlich, Sior Maschera“, sagte er, sie beim Namen aller Maskierten nennend. Er deutete eine Verbeugung an, die auf Ilaria geziert wirkte.
„Buonasera“, sagte Ilaria. „Wie sehe ich aus?“
Enrico musterte sie von oben bis unten. „Fast so gut wie ich.“ Er grinste. „Dein seltsames Muttermal hättest du überkleben sollen.“
„Es ist nicht seltsam.“
„Doch. Es sieht aus wie eine dreieckige Warze.“
„Es gibt keine dreieckigen Warzen. Außerdem spricht aus dir nur der Neid, denn ich besitze, wofür andere Mouches verwenden.“
„Sie benutzen Mouches, um derartige Makel zu verdecken.“
„Es ist kein Makel, sondern ein Vorzug.“
„Rede es dir nur ein.“
Ilaria schnitt eine Grimasse. „Hättest du mir eben eine Maschera nobile beschafft, wie ich es vorgeschlagen habe.“
Die Kombination aus weißer Wachsmaske, schwarzer Kapuze, einem dunklen Mantel und Dreispitz war Ilarias Ansicht nach die beste Verkleidung, wollte man nicht erkannt werden.
„Erstens, Schwesterlein“, sagte Enrico, „darf die Maschera nobile nur von Männern getragen werden. Zweitens überschreitet diese Maske meine bescheidenen Finanzen.“ Er nahm seine Schnupftabakdose aus der Rocktasche. „Wie du mittlerweile wissen solltest, muss ich für alle Ausgaben Rechenschaft ablegen. Filomena erlaubt keine Maschera nobile, warum auch immer.“ Er hob die Achseln. „Also gibt es keine.“
Ilaria lachte. „Sicherlich weil sie denkt, der Schutz der Maschera nobile würde dich zu Schandtaten verleiten. Dabei sollte sie längst wissen, dass du dafür keine Maske benötigst.“
„Haha, das musst gerade du sagen.“ Er nahm mit den Fingerspitzen Schnupftabak und sog ihn genüsslich ein. „Nein“, sagte er, „der Grund ist Filomenas Geiz. Diese Verkleidung erfüllt keinen Doppelnutzen. Man kann sie nicht mehr in der Kirche tragen, seit dem Verbot des Großen Rates.“
Ilaria lachte. „Weil du so häufig in die Kirche gehst.“
„Nur weil du frömmelst, ist das kein Grund, meine Gewohnheiten in Frage zu stellen.“
„Ich frömmele nicht“, sagte Ilaria. „Doch um nochmals auf deine spärliche Maskerade zurückzukommen. Hast du dir niemals die Frage gestellt, dass Filomena dich darin einschränkt, damit sie dir leichter nachspionieren kann?“
Enrico lachte und nieste zugleich. Schnell hob er ein Spitzentaschentuch vor sein Gesicht. „Nachspionieren? Warum sollte sie das tun?“ Über den Rand des Tuchs blickte er Ilaria an. „Ah, du denkst, wegen dir. Du hast mich während des gesamten letzten Carnevale begleitet und niemand hat Verdacht geschöpft. Warum sollte Filomena gerade jetzt argwöhnisch werden?“
Ilaria biss sich auf die Lippen. „Sie … sie hat mein Tagebuch gelesen.“
Enrico verstaute seine Schnupftabakdose und starrte sie entgeistert an. „Du hast doch nicht etwa von unseren Ausflügen hinein geschrieben?“
Sie wich einen Schritt zurück, da seine plötzliche Heftigkeit sie überraschte. „Nein, denkst du ich bin wahnsinnig? Es war so schon schlimm genug, zu hören, wie sie sich in ihrem Büro vor anderen über mich lustig gemacht hat. Als wären meine Gedanken und Träume nur die Dummheiten eines Kindes.“
Er lächelte. „Soso, du hast also an der Wand gelauscht?“
„An der Tür hört man besser.“ Sie senkte den Kopf. „Ich habe mein Tagebuch daraufhin sofort vernichtet.“
„Und deine Gedichte?“ fragte er.
„Alle zerstört. Es gibt nichts mehr.“
Enrico sah sie schweigend an. Sie war ihm dankbar, dass er das Thema ruhen ließ. Es tat zu weh.
„Gehen wir jetzt weiter oder willst du hier festwachsen?“ Enricos Stimme bebte vor Ungeduld. Er wartete nicht auf Ilaria, sondern lief sofort los. Sie eilte ihm nach.
„Da kommst du ja endlich“, sagte er. „Ich dachte schon, du wolltest die Nacht vertrödeln.“ Er lächelte sie an.
„Habe ich nicht vor.“ Ilaria zwang sich, das Lächeln zu erwidern, was ihr jedoch nicht so recht gelang. Wie gern besäße sie Enricos Zuversicht. Doch dieser hatte leicht reden. Im Gegensatz zu ihr stand für ihn weder sein Status noch seine Zukunft auf dem Spiel. Der Preis, erkannt zu werden, war für Ilaria hoch, womöglich zu hoch, doch wer wusste, wie lange sie dieses bisschen Freiheit noch besitzen würde.
Enrico deutete auf den von Fackeln erleuchteten Eingang eines Palazzo. „Dies ist das Ca’ Mandarno.“ Ilaria vernahm gedämpfte Musik und Stimmengemurmel aus selbigem. Wie so oft empfand sie Befangenheit bei dem Gedanken, dort hineinzugehen zu all den fremden Menschen.
Offenbar missdeutete Enrico ihr Zögern, denn er sagte: „Die Contessa Mandarno ist bekannt für ihre Salons, in denen sie Dichter, Maler und Philosophen um sich schart.“
Sie nickte leicht. „Eine Dame von Welt.“
„Gewiss. Zudem ist sie hübsch und äußerst freigiebig in ihrer Gunst.“ Er lächelte. „Besonders mir gegenüber.“
„Soso. Ich dachte, die Dame wäre verheiratet.“
„Ist sie auch.“
„Und das hindert dich nicht an einer Affäre mit ihr?“
Er hob die Achseln. „Das machen doch alle.“
Ursula Donner
Seit 1998 schreibe ich Gedichte. Jahre später verfasste ich meinen ersten Roman, der im Königreich Ungarn spielte. Dieses Werk ruht auf dem Datenfriedhof.
“Sohn der Nacht” ist mein zweiter Roman oder der fünfte, je nachdem ob man die zweihundert gekürzten Seiten, die unzähligen Änderungen und neu geschriebenen Seiten mitrechnet.
Eine meiner wichtigsten Erkenntnisse ist, dass man auch auf diesem Gebiet immer ein Lernender sein wird.
Es gibt es so viel Interessantes zu lernen und zu erfahren, dass ein Leben und auch Hunderte davon nicht ausreichen. Dies ist auch einer der Gründe, warum ich schreibe. Es ermöglicht mir, mehrere Leben gleichzeitig zu leben, über meine begrenzte Welt hinwegzuschauen und gleichzeitig tiefer zu gehen, bis dorthin, wo die Instinkte und die Antriebe der Menschen liegen.
Von Ursula Donner